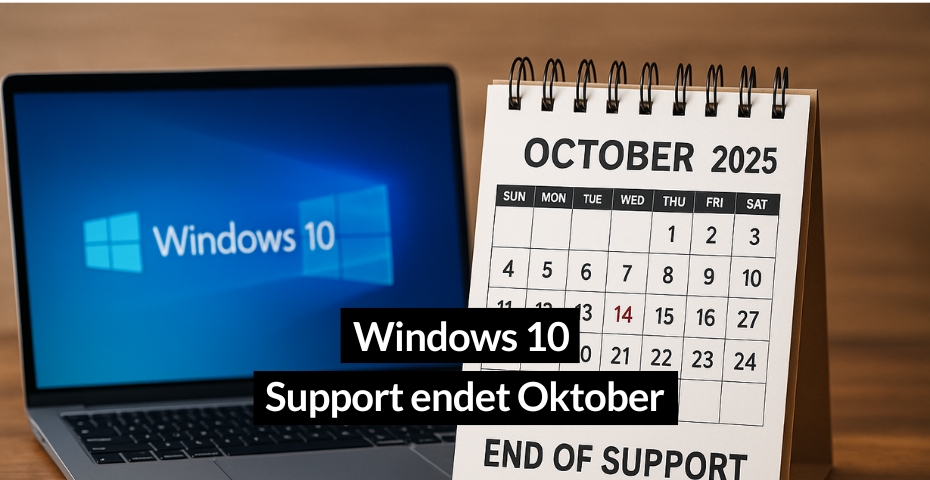Am 14. Oktober 2025 endet der kostenfreie Support für Windows 10. Ab diesem Zeitpunkt erhalten Nutzerinnen und Nutzer keine regelmäßigen Sicherheitsupdates, Fehlerkorrekturen oder technischen Support mehr. Die Systeme laufen zwar weiter, erfüllen jedoch nicht mehr den Stand der Technik in Bezug auf IT-Sicherheit. Für kleine und mittlere Unternehmen bedeutet das: Bekannte Sicherheitslücken werden ab diesem Zeitpunkt nicht mehr geschlossen. Das bedeutet: Kriminelle können gezielt Schwachstellen ausnutzen, um in Systeme einzudringen. Für Unternehmen steigt damit das Risiko von Datenverlust, Ausfällen und Schadsoftware erheblich. Hinzu kommt: Viele gesetzliche Anforderungen an Datenschutz und IT-Sicherheit lassen sich ohne aktuelle Sicherheitsupdates kaum noch erfüllen. Wer den Umstieg auf ein neues System aufschiebt, läuft Gefahr, dass der Betrieb im Ernstfall stillsteht und dass kurzfristige Notfalllösungen deutlich teurer werden als eine rechtzeitige Umstellung.
Warum das Support-Ende für kleine Unternehmen besonders relevant ist
Gerade kleinere Unternehmen betreiben ihre IT mit knappen Ressourcen und ohne eigene Abteilung für Informationssicherheit. Hier wirkt sich der Wegfall von Sicherheitsupdates besonders stark aus: Ein einzelnes ungepatchtes System kann zur Schwachstelle für das gesamte Unternehmensnetzwerk werden. Hinzu kommt, dass immer mehr Geschäftspartner und Auftraggeber aktuelle Softwarestände verlangen, um gemeinsame Sicherheitsstandards einzuhalten. Auch aus Compliance-Sicht ist der Weiterbetrieb von Windows 10 nach Oktober 2025 problematisch: Vorschriften wie die DSGVO oder das IT-Sicherheitsgesetz fordern den Einsatz aktueller Sicherheitsmaßnahmen – und genau das ist mit einem abgekündigten Betriebssystem nicht mehr gewährleistet.
Gut zu wissen: Die Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand bietet kostenfreie Angebote wie den CYBERsicher Check, Dialogleistungen und eine Notfallhilfe. Diese Tools helfen Ihnen, Ihre IT-Sicherheit zu analysieren und passende Maßnahmen in Ihre Migrationsplanung zu integrieren.
Übergangslösung ESU-Programm – aber keine Dauerstrategie
Microsoft bietet für Unternehmen als Zwischenlösung ein kostenpflichtiges „Extended Security Updates“-Programm (ESU) an. Damit lassen sich kritische Sicherheitsupdates für Windows 10 auch nach dem 14. Oktober 2025 noch für begrenzte Zeit beziehen. Der Service kostet im ersten Jahr 61 US-Dollar pro Gerät. Ab dem zweiten Jahr verdoppelt sich der Preis auf 122 US-Dollar, im dritten Jahr auf 244 US-Dollar pro Gerät.
Für Unternehmen kann dies eine kurzfristige Entlastung darstellen, wenn die Migration aus personellen oder finanziellen Gründen nicht sofort möglich ist. Allerdings steigen die Kosten mit jedem Jahr, und die ESU-Laufzeit ist begrenzt. Unternehmen sollten das Programm daher nur als temporäre Absicherung sehen, nicht als Ersatz für eine klare Migrationsstrategie. Entscheidend bleibt, frühzeitig Alternativen zu prüfen und einen verbindlichen Fahrplan für die Ablösung von Windows 10 festzulegen.
Was Sie jetzt tun können: 6 Wege, Windows 10 rechtzeitig abzulösen
Für kleine und mittlere Unternehmen gibt es mehrere Wege, um Windows 10 rechtzeitig abzulösen. Je nach Ausgangslage – z. B. Hardware-Ausstattung, Budget, vorhandene IT-Ressourcen – können folgende Optionen einzeln oder kombiniert in Betracht gezogen werden
Upgrade auf Windows 11 (bei kompatibler Hardware)
Die einfachste Möglichkeit ist, bestehende Windows-10-Rechner, die die Anforderungen erfüllen, direkt auf Windows 11 zu aktualisieren. Das neue Betriebssystem bietet modernere Sicherheitsfunktionen wie TPM 2.0 und Secure Boot und erhält weiterhin regelmäßige Updates. Ein direktes Upgrade ist über Windows Update möglich, allerdings sollten Unternehmen vorher prüfen, ob die Geräte kompatibel sind (z.B. via PC Health Check Tool). Windows 11 verlangt in der Regel eine 64-Bit-CPU, UEFI mit Secure Boot, TPM 2.0 und mindestens 8 GB RAM. Ältere Rechner, die diese Anforderungen nicht erfüllen, müssen aufgerüstet oder ersetzt werden.
Ein In-Place-Upgrade behält Einstellungen, Anwendungen und Dateien bei, wodurch der Umstieg schneller gelingt. Alternativ kann Windows 11 neu installiert werden, das liefert ein „sauberes“ System, erfordert aber die Neuinstallation aller Programme und die Übernahme der Daten aus Backups.
Unternehmen sollten zudem daran denken, Mitarbeitende zu schulen, da sich Bedienoberfläche und Funktionen im Vergleich zu Windows 10 deutlich ändern.
Anschaffung neuer Hardware mit Windows 11
Falls viele vorhandene Rechner Windows 11 nicht unterstützen (etwa wegen fehlendem TPM 2.0 oder zu alter CPU), führt kaum ein Weg an Hardware-Investitionen vorbei. Moderne PCs werden heute meist mit Windows 11 vorinstalliert geliefert.
Frühzeitige Planung erlaubt es jedoch, die Beschaffung zu staffeln, statt alle Geräte auf einmal ersetzen zu müssen. Neue Hardware bringt neben voller Windows 11-Unterstützung auch Leistungs‑ und Zuverlässigkeitsverbesserungen, was die Produktivität steigern kann. Wichtig: Bei der Ausmusterung alter Geräte sollte an sichere Datenlöschung und Recycling gedacht werden (vgl. Gerätelebenszyklus-Management).
Extended Security Updates (ESU) als zeitlich begrenzte Lösung
Wie oben bereits erklärt, erlaubt das ESU-Programm von Microsoft Unternehmen, ausgewählte Windows-10-Geräte gegen eine jährliche Gebühr weiter mit kritischen Sicherheitsupdates zu versorgen. Die Kosten steigen jedes Jahr, und neue Funktionen oder Qualitätsupdates gibt es nicht mehr. ESU bietet damit nur einen kurzfristigen Aufschub, um Zeit für Hardware-Erneuerung oder Anpassungen bei Spezialsoftware zu gewinnen. Langfristig sollten Unternehmen die Umstellung auf Windows 11 oder einen Nachfolger planen, denn jedes Jahr verlängertes Windows 10 erhöht Aufwand und Kosten.
Weitere Alternative zum Update auf Windows 11: Cloud-Lösungen (Windows 365 / Azure Virtual Desktop)
Wer Hardwarekosten verschieben oder mobilen Mitarbeitenden einen flexiblen Zugriff ermöglichen möchte, kann den Desktop-Betrieb in die Cloud verlagern. Mit Windows 365 Cloud-PC oder Azure Virtual Desktop greifen Mitarbeitende auf eine virtuelle Windows-11-Umgebung zu – auch auf älteren PCs oder Thin Clients. Die Windows-Instanz läuft in Microsofts Cloud und bleibt automatisch aktuell. So können Unternehmen vorhandene Windows-10-Geräte weiter nutzen, während Nutzer einen gestreamten Windows-11-Desktop erhalten, inklusive Sicherheitsupdates.
Zu beachten sind laufende Cloud-Abonnementkosten pro Nutzer und die Notwendigkeit einer stabilen Internetverbindung. Wie oben bereits erklärt, ersetzt diese Lösung keinen dauerhaften Umstieg auf ein unterstütztes System, sondern verschafft nur Übergangszeit.
Drittanbieter-Sicherheitsupdates (z. B. 0patch)
Abseits offizieller Pfade gibt es Lösungen wie 0patch von ACROS Security, die versprechen, Windows 10 nach 2025 weiter abzusichern. Das 0patch-Team plant, für Windows 10 mindestens fünf Jahre lang kritische Sicherheitslücken mit sogenannten Micropatches zu schließen. Diese Micropatches sind winzige in-memory Patch-Dateien, die Sicherheitslücken im laufenden System stopfen, ohne die Original-Binärdateien von Microsoft zu verändern. Für Privatanwender ist 0patch teilweise kostenlos (für als gravierend eingestufte Lücken). Vollständigen Schutz erhält man über kostenpflichtige Pakete.
Dennoch bleibt es ein inoffizieller Ansatz mit Restrisiko: Unternehmen müssen selbst bewerten, ob sie einem Drittanbieter-Patch vertrauen möchten. Zudem wird spätestens Ende der 2020er Jahre auch die Anwendungs-Unterstützung für Windows 10 enden (Browser, Office, Branchensoftware), sodass der Betrieb über 2028/29 hinaus wenig Sinn ergibt. 0patch kann also maximal etwas Zeit schinden – die letztliche Migration auf ein unterstütztes OS ersetzt es nicht.
Umstieg auf alternative Betriebssysteme
In Einzelfällen mag ein vollständiger Plattformwechsel in Betracht kommen. Ältere Hardware, die Windows 11 nicht packt, lässt sich etwa mit Linux weiter nutzen. Moderne benutzerfreundliche Linux-Distributionen (Ubuntu, Linux Mint, Zorin OS etc.) sind kostenlos, erhalten regelmäßige Updates und gelten als sicher. Auch ChromeOS Flex (eine Cloud-orientierte OS-Variante von Google) kann auf alten PCs installiert werden.
Allerdings ist der Wechsel weg von Windows für Unternehmen ein großer Schritt: Mitarbeiter müssten geschult werden, und spezielle Windows-Software läuft ggf. nicht nativ unter Linux. Diese Option eignet sich eher, wenn viele Arbeitsprozesse ohnehin webbasiert ablaufen oder Plattformunabhängigkeit in der IT-Strategie verankert ist. Im deutschen Mittelstand ist der Wechsel zu Linux aber noch die Ausnahme. Alternativ könnten manche Firmen erwägen, auf macOS umzusteigen – was jedoch hohe Hardwarekosten und ebenfalls Anpassungsaufwand mit sich bringt. Fazit: Ein alternatives OS ist für Unternehmen nur dann sinnvoll, wenn klare strategische oder technische Vorteile überwiegen. In den meisten Fällen wird ein Verbleib im Windows-Ökosystem (Windows 11 oder Nachfolger) praktikabler sein.
Roadmap: Schritt-für-Schritt zur erfolgreichen Migration
Unabhängig davon, welche Option(en) Sie wählen – entscheidend ist ein geplanter Migrationsprozess, um böse Überraschungen zu vermeiden. Nachfolgend finden Sie eine empfohlene Roadmap in fünf Schritten, die sich aus verschiedenen Migrationsleitfäden und Best Practices ableitet:
- Bestandsaufnahme und Kompatibilitäts-Check: Erstellen Sie eine vollständige Übersicht aller Windows-10-Geräte, inklusive Versionsstand (z. B. 21H2/22H2). Prüfen Sie für jedes Gerät die Windows-11-Kompatibilität, etwa mit dem PC Health Check Tool, und identifizieren Sie kritische Anwendungen und Arbeitsprozesse.
Ergebnis dieses Schritts: eine Prioritätenliste, welche PCs sofort upgradefähig sind, welche aufgerüstet oder ersetzt werden müssen, und welche Altsysteme (z. B. in der Produktion) oder Spezialsoftware besondere Aufmerksamkeit erfordern. Überlegen Sie außerdem, wie Sie Sicherheit für unverzichtbare Altsysteme gewährleisten, falls diese vorübergehend über das Support-Ende hinaus betrieben werden (Segmentierung, zusätzliche Schutzmaßnahmen). - Strategie festlegen (Upgrade vs. Überbrücken): Basierend auf der Bestandsaufnahme entscheiden Sie, wie die Umstellung erfolgen soll. Wo ein direktes Upgrade auf Windows 11 möglich ist, planen Sie diesen Schritt ein – ggf. inkl. erforderlicher Hardware-Upgrades (RAM, SSD, TPM-Modul nachrüsten) für grenzwertige Systeme. Für Geräte, die nicht upgradefähig sind, bestimmen Sie den weiteren Weg: Austausch durch neue Windows 11-Hardware, temporäre Absicherung via ESU oder 0patch, oder Migration in eine virtuelle Desktop-Umgebung.
Führen Sie eine Kosten-Nutzen-Analyse durch: Was kostet es, jetzt in neue Hardware zu investieren, verglichen mit den Lizenzkosten für 2–3 Jahre ESU und dem Risiko veralteter Geräte? Oft ist eine Mischung sinnvoll – z. B. ältere kritische Server/PCs per ESU noch 1–2 Jahre absichern, während der Rest direkt auf Windows 11 wechselt. Legen Sie konkrete Ziele und Meilensteine fest: etwa “Bis Q2 2025 sind 80 % der Clients auf Windows 11” usw. - Detailplanung und Testen: Erstellen Sie einen detaillierten Zeitplan, planen Sie Pilotphasen und testen Sie das Windows-11-Upgrade zunächst auf weniger kritischen Geräten. Prüfen Sie die Kompatibilität aller wichtigen Anwendungen unter Windows 11 und besorgen Sie Updates oder Patches für Software, die noch nicht offiziell unterstützt wird. Definieren Sie den Rollout-Plan, z. B. abteilungsweise oder nach Gerätegeneration. Sorgen Sie für Backups aller Daten und Benutzerprofile, bevor Sie produktive Maschinen umstellen. Kommunizieren Sie den Plan frühzeitig an Mitarbeitende, besonders wenn Änderungen im Workflow oder kurze Downtimes zu erwarten sind. Bei Nutzung von ESU oder 0patch: Lizenzen rechtzeitig beschaffen und Systeme einrichten. Bei Cloud-Lösungen: Benutzerkonten einrichten, Performance testen und Zugriffsrechte definieren.
- Durchführung der Umstellung: Führen Sie die Umstellungen gemäß Plan durch. Beginnen Sie mit den priorisierten Geräten/Abteilungen und rollen Sie Windows 11 schrittweise aus, um die Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb zu minimieren. Nach jedem Batch von Upgrades sollten kurze Funktionsprüfungen und Feedback-Runden erfolgen, um eventuelle Probleme früh zu erkennen. Sorgen Sie für Support während der Übergangsphase – z. B. einen Ansprechpartner in der IT, der bei Benutzerfragen zu Windows 11 hilft.
Parallel dazu: Halten Sie Windows 10-Geräte, die noch nicht migriert sind, so sicher wie möglich (letzte Updates einspielen, lokale Admin-Rechte einschränken, Internetzugang beschränken, etc.). Wenn ESU oder 0patch im Einsatz sind, überwachen Sie die Update-Versorgung dieser Systeme genau (funktionieren die Updates, treten Nebenwirkungen auf?). Dokumentieren Sie den Fortschritt laufend und passen Sie den Zeitplan an, falls nötig – etwa wenn Lieferengpässe bei neuer Hardware auftreten oder Tests unerwartete Probleme offenbaren. - Nachbereitung und langfristige Planung: Nach Abschluss des Umstiegs prüfen Sie, dass alle Sicherheitsfunktionen von Windows 11 aktiviert sind (z. B. BitLocker, SmartScreen, aktuelle Antivirus-Lösungen) und Updates regelmäßig eingespielt werden. Verbleibende Windows-10-Geräte klar kennzeichnen und deren Ablösung fest einplanen – spätestens 2028 endet auch der erweiterte Support endgültig.
Nutzen Sie die Erfahrungen aus dem Projekt, um künftig proaktiver zu handeln: Microsoft folgt etwa 10-Jahres-Zyklen für Windows-Versionen, daher empfiehlt sich mittelfristige Budgetplanung. Überlegen Sie auch hybride Modelle aus Cloud-Desktops und lokalen PCs, um zukünftige Umstellungen flexibler zu gestalten. Wichtig ist, dass IT und Geschäftsführung gemeinsam eine kontinuierliche Strategie für IT-Modernisierung entwickeln, statt auf einen „Big Bang“ am End-of-Life-Datum zu setzen.
Fazit: Mit Planung sicher durch das Support-Ende
Ein gut vorbereiteter Migrationsplan wie oben skizziert versetzt Unternehmen in die Lage, das Windows 10-Ende ohne Panik und ohne Sicherheitsdesaster zu bewältigen. Indem frühzeitig inventarisiert und strategisch geplant wird, lassen sich Kosten verteilen und Ausfallzeiten minimieren.
Die vorgestellten Optionen – vom direkten Windows 11-Upgrade über temporäre ESU-Patches bis hin zu Cloud-Lösungen – bieten für unterschiedliche Budget- und Ressourcenlagen passende Wege. Kleinere Mittelständler mit begrenzten IT-Teams können so einen Pfad wählen, der für sie praktikabel ist, und müssen nicht bis zum letztmöglichen Moment warten.
Natürlich erfordert jede Migration Aufwand und Anpassung; doch wer jetzt handelt, bleibt auch ab Oktober 2025 sicher und handlungsfähig. Mit der oben beschriebenen Roadmap und etwas Vorlaufzeit sind Unternehmen gut gewappnet, um ungeplante Notfall-Investitionen zu vermeiden und ihre IT-Umgebung zukunftssicher aufzustellen. Das Ziel sollte sein, bis zum Stichtag 2025 größtenteils auf Windows 11 (oder eine Alternative) umgestiegen zu sein, um anschließend wieder auf den regulären Update-Pfad zu gelangen – denn proaktive Modernisierung ist langfristig kostengünstiger und risikoärmer als reaktives Krisenmanagement.
Tipp: Das Mittelstand-Digital Zentrum Berlin bietet Unternehmen keine direkte Migrationsunterstützung, wohl aber praxisnahe Hilfen rund um IT-Sicherheit, Datenmanagement und KI-Readiness. Diese Themen spielen auch bei der Ablösung veralteter Systeme eine wichtige Rolle – zum Beispiel, wenn es darum geht, Sicherheitsstandards einzuhalten oder neue Anwendungen sinnvoll einzubinden. Nutzen Sie hierfür unsere kostenfreien Workshops und Checklisten.
—
Text: Alexander Krug