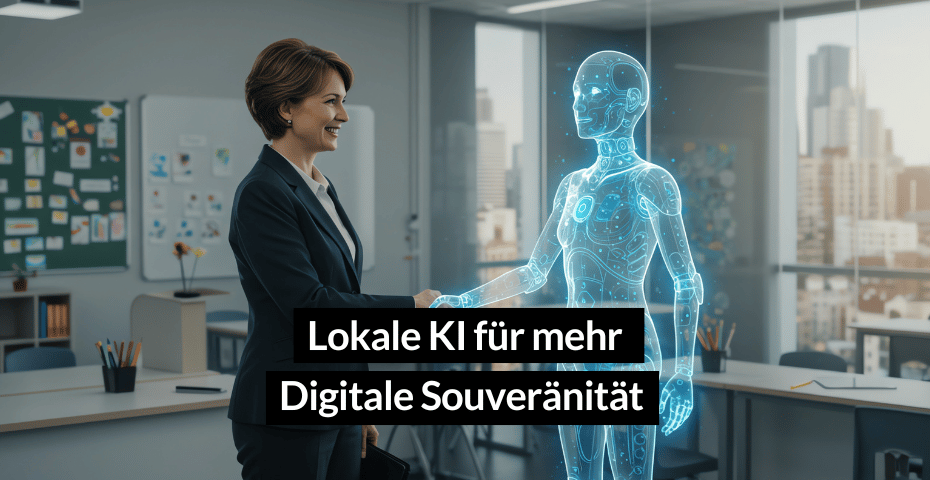Wer Künstliche Intelligenz nutzt, sollte wissen, wo die Daten landen. Für mittelständische Unternehmen birgt der Einsatz von cloudbasierter KI aus den USA oder Asien große Risiken – rechtlich wie wirtschaftlich. Lokale KI-Modelle bieten eine Alternative: Sie schützen sensible Daten, erhöhen die Effizienz und stärken die Kontrolle im Unternehmen. Erfahren Sie, wie das funktioniert, welche Tools es gibt und warum gerade jetzt die Zeit für mehr digitale Unabhängigkeit ist.
Cloud-Abhängigkeit birgt Risiken für Unternehmen
Mehr als 60 % der Unternehmensdaten weltweit liegen heute in der Cloud – bei großen Anbietern wie Amazon, Microsoft oder Google, oft in den USA oder Asien. Diese Anbieter – sogenannte Hyperscaler – betreiben riesige Rechenzentren, in denen ein Großteil aller KI-Anwendungen läuft. Prognosen gehen davon aus, dass bis 2030 rund 60–65 % aller KI-Workloads auf solchen Infrastrukturen verarbeitet werden.
Eine aktuelle Bitkom‑Studie zeigt: Auch 96 % der deutschen Unternehmen nutzen digitale Technologien oder Services aus dem Ausland, davon 87 % aus den USA. Mehr als 78 % sehen darin eine zu große Abhängigkeit von US‑Cloud‑Anbietern.
Die Umfrage zeigt eine wachsende Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft vom Import ausländischer digitaler Technologien und Dienstleistungen bei gleichzeitigem Vertrauensverlust durch aktuelle Kreisen.
So sehen sich laut der Umfrage nach dem Wahlsieg von Donald Trump im November 2024 deutsche Unternehmen einer unsicheren Zukunft gegenüber. Mehr als ein Drittel sehen ihr Vertrauen erheblich geschwächt, 60 Prozent zumindest leicht.

Die Konzentration auf wenige große Anbieter außerhalb Europas wirft Fragen nach Datenkontrolle, rechtlicher Sicherheit und langfristiger Unabhängigkeit auf.
Unternehmen, die auf lokale KI setzen – also KI, die direkt auf eigenen Geräten oder Servern läuft –, behalten die volle Kontrolle über ihre Daten, handeln konform nach europäischem Recht und stärken ihre digitale Souveränität.
Digitale Souveränität: Ein Standortvorteil mit Zukunft
Digitale Souveränität ist mehr als ein Schlagwort – sie ist ein wirtschaftlicher Überlebensfaktor. Wer technologische Abhängigkeiten reduziert, erhöht seine Resilienz.
Gerade Unternehmen, die mit sensiblen Kundendaten arbeiten, geraten bei der Nutzung ausländischer Cloud-Dienste schnell in eine rechtliche Grauzone. Dienste aus den USA oder Asien unterliegen nicht der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) – das kann zu Datenabfluss, Sicherheitslücken und einem Vertrauensverlust bei Kundinnen und Kunden führen.
Cloud war gestern: Die Vorteile lokaler KI-Modelle
Lokale KI-Modelle, auch als „On-Device-KI“ bezeichnet, verarbeiten Daten direkt auf der Hardware eines Unternehmens. Das vermeidet die Übertragung sensibler Daten in externe Clouds und bringt klare Vorteile: mehr Datenschutz, geringere Verzögerungen und weniger Abhängigkeiten von globalen Cloud-Anbietern.
So kann beispielsweise ein Maschinenbauer, der Sensoren an seinen Produktionsanlagen nutzt, in Echtzeit den Zustand der Maschinen überwachen. Die lokale KI analysiert die Daten direkt vor Ort und ermöglicht so eine vorausschauende Wartung – ohne dass sensible Betriebsdaten das Unternehmen verlassen. Das spart langfristig Kosten, erhöht die Anlagenverfügbarkeit und bewahrt die Kontrolle über wertvolle Unternehmensdaten.
Auch im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen kann die lokale Verarbeitung der Patientendaten von Vorteil sein: Es schützt sensible Informationen vor unbefugtem Zugriff und erfüllt gleichzeitig strenge Datenschutzanforderungen, ohne auf die Cloud großer Anbieter angewiesen zu sein.
Diese Beispiele zeigen: Lokale KI ist kein Zukunftsthema, sondern ein wirksames Instrument, um Effizienz zu steigern, Datenschutz zu gewährleisten und digitale Souveränität zu stärken. Die unmittelbare Datenverarbeitung reduziert außerdem Latenzzeiten und sorgt für schnellere Reaktionszeiten – ein entscheidender Faktor in vielen Produktions- oder Serviceprozessen.
3 Tools für Lokale KI-Modelle: Anwendungen und Kosten im Überblick
Für Unternehmen, die lokale KI-Lösungen umsetzen möchten, gibt es inzwischen eine wachsende Auswahl an Plattformen und Tools, die den Einstieg erleichtern – auch mit begrenztem Budget und ohne tiefe Programmierkenntnisse:
1. Lokale KI gestalten: So funktioniert LM Studio in der Praxis
LM Studio ist eine Plattform, die Unternehmen ermöglicht, eigene KI-Modelle lokal zu trainieren und einzusetzen. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die große Auswahl an vorgefertigten Modellen machen die Plattform besonders für Betriebe interessant, die individuelle KI-Anwendungen ohne Cloud-Abhängigkeit entwickeln möchten.
In der Praxis nutzen beispielsweise kleine Softwarehäuser LM Studio, um Dokumente und Kundenanfragen automatisch auszuwerten und so den Support effizienter zu gestalten. Auch mittelständische Fertigungsunternehmen setzen die Plattform ein, um Bilddaten aus der Qualitätskontrolle vor Ort zu analysieren und fehlerhafte Produkte schneller zu erkennen, ohne sensible Bilddaten extern weitergeben zu müssen.
Die Basisversion von LM Studio ist für den internen Unternehmensgebrauch kostenlos verfügbar, was besonders für kleinere Unternehmen und Pilotprojekte attraktiv ist. Für den professionellen Einsatz mit erweiterten Funktionen, Support und kommerzieller Lizenzierung fallen jedoch Kosten an. Diese liegen laut Herstellerangaben im Bereich von mehreren Hundert bis über 1.000 Euro pro Jahr, abhängig vom Umfang der Nutzung und den gewünschten Features. Eine genaue Preisliste veröffentlicht LM Studio nicht öffentlich.
LM Studio eignet sich besonders für Unternehmen, die eigene Modelle lokal anpassen und trainieren möchten.
2. Schneller Einstieg mit Open Source: KI-Entwicklung mit Ollama
Auch Ollama ist eine Plattform, die Unternehmen die Entwicklung und den Betrieb von KI-Modellen direkt auf lokalen Geräten ermöglicht. Die Plattform unterstützt eine breite Palette von Anwendungen, darunter Bildverarbeitung, Sprachanalyse und Simulationen. Durch die lokale Verarbeitung werden Daten nicht in externe Clouds übertragen, was den Datenschutz verbessert und Abhängigkeiten reduziert.
Die Kosten für Ollama liegen nach verfügbaren Angaben zwischen etwa 100 und 300 Euro monatlich, abhängig von Rechenleistung und Supportleistungen. Für Unternehmen ist zu beachten, dass der Betrieb lokaler KI-Systeme entsprechende Hardwareanforderungen und IT-Kompetenz voraussetzt.
Ollama eignet sich besonders für Betriebe, die lokal mit Open-Source-Modellen arbeiten wollen – z. B. für Texte oder Bilder.
3. PrivateGPT: Generative KI mit maximaler Privatsphäre
Für Unternehmen, die besonders hohe Anforderungen an den Datenschutz stellen, bietet PrivateGPT einen lokalen Ansatz für den Einsatz generativer KI.
Die Software verarbeitet Daten vollständig innerhalb der eigenen IT-Infrastruktur – ohne Verbindung zu externen Servern. Das ermöglicht Anwendungen in Bereichen wie Recht, Beratung oder Gesundheitswesen, in denen der Schutz sensibler Informationen oberste Priorität hat. PrivateGPT durchsucht zum Beispiel interne Dokumente, Verträge oder E-Mails und beantwortet Fragen auf Basis firmeneigener Inhalte. Dabei kommt eine sogenannte RAG-Pipeline zum Einsatz: Texteingaben werden zunächst anonymisiert, bevor sie verarbeitet und später datenschutzkonform re-identifiziert werden. Die Antworten entstehen ausschließlich auf Grundlage lokal gespeicherter Daten, was eine nachvollziehbare Dokumentation und Kontrolle erlaubt.
Der Betrieb ist allerdings technisch anspruchsvoll: Für die Nutzung komplexerer Modelle werden leistungsfähige Server mit dedizierten GPUs benötigt. Die Lizenzkosten variieren je nach Funktionsumfang und Unternehmensgröße – genaue Preise sind meist nur auf Anfrage erhältlich.
PrivateGPT ist damit vor allem für Organisationen interessant, die generative KI mit maximaler Datenhoheit einsetzen wollen z. B. Gesundheit, Recht, Beratung und die nötige Infrastruktur bereits vorhalten.
Neben Tools wie LM Studio, Ollama und PrivateGPT gibt es eine wachsende Zahl an Open-Source-Alternativen, die lokale KI-Anwendungen ermöglichen. Dazu gehören Plattformen wie LocalAI oder GPT4All, die auf eigenen Geräten laufen und vielfältige Sprachmodelle unterstützen. Jan, NextChat und Text Generation Web UI bieten ebenfalls datenschutzfreundliche Umgebungen für Chat-Anwendungen, teils mit OpenAI-kompatibler API. Diese Lösungen richten sich an technisch versierte Unternehmen, die eigene KI-Systeme flexibel und unabhängig betreiben möchten.
Unterstützung durch EU und Bundesregierung: Förderprogramme und KI-Infrastruktur
Auch die Europäische Union und die deutsche Bundesregierung fördern aktiv den Einsatz Künstlicher Intelligenz und die Digitalisierung im Mittelstand – mit einem besonderen Fokus auf datenschutzfreundliche Technologien und europäische Unabhängigkeit.
So entsteht in Jülich (NRW) aktuell eine von insgesamt sechs europäischen KI-Fabriken, die über 485 Millionen Euro investiert werden. Die europäische KI-Fabrik stellt nicht nur großen Konzernen, sondern explizit auch kleinen Unternehmen KI-Rechenleistung zur Verfügung – etwa für das Training eigener Modelle, Simulationen oder die Verarbeitung großer Datenmengen.
Ziel ist es, den KI-Innovationsstandort Deutschland zu stärken und KI-Anwendungen ohne Abhängigkeit von Nicht-EU-Anbietern zu entwickeln.
Ein anderes Beispiel ist das „CitiVERSE EDIC“, das moderne KI-Tools anwendet, um lokale digitale Zwillinge für intelligente Gemeinschaften zu entwickeln. Diese digitalen Zwillinge helfen Städten, Prozesse zu simulieren und zu optimieren, vom Verkehrsmanagement bis zur Abfallwirtschaft. Solche praxisnahen Anwendungen zeigen, wie lokale Technologien Mehrwert schaffen können.
Darüber hinaus spielt auch das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) des Bundes eine zentrale Rolle: Das ZIM‑Programm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz fördert Forschungs‑ und Entwicklungsprojekte in kleinen und mittleren Unternehmen – darunter auch solche mit KI-Fokus. Es unterstützt Einzelunternehmen und Kooperationen mit Forschungseinrichtungen. Die Förderquoten reichen je nach Unternehmensgröße von 25 bis 55 %, bei einem Zuschussvolumen bis zu 550.000 € je Einzelprojekt oder 560.000 € je Kooperationsprojekt. (zur aktuellen ZIM Richtlinie: Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) – ZIM-Richtlinie 2025)
Die Bedeutung von Cybersicherheit
Cybersicherheit ist ein kritischer Erfolgsfaktor für die digitale Zukunft von Unternehmen. Fast alle Betriebe sehen Cybersecurity als entscheidend an, aber nur eine Minderheit hat ein umfassendes Sicherheitskonzept. Angesichts zunehmender Bedrohungen ist es essenziell, robuste Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren, um die digitale Souveränität und den Schutz sensibler Daten zu gewährleisten.
Ein umfassendes Sicherheitskonzept umfasst nicht nur technische Maßnahmen wie Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und regelmäßige Systemupdates, sondern auch organisatorische Aspekte: Notfallpläne für Cybervorfälle, regelmäßige Sicherheitsaudits sowie gezielte Schulungen der Mitarbeitenden, um sie für Gefahren wie Phishing oder Social Engineering zu sensibilisieren.
Ethische und nachhaltige Herausforderungen
Der Einsatz von KI bringt auch ethische und nachhaltige Herausforderungen mit sich. Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre KI-Initiativen nicht nur technologisch fortschrittlich, sondern auch sozial und ökologisch verantwortungsbewusst sind. So ist es wichtig, mögliche Verzerrungen (Bias) in den KI-Modellen zu erkennen und zu vermeiden – etwa bei Anwendungen im Recruiting oder in der Kundensegmentierung. Zudem trägt Local-first-KI durch lokale Datenverarbeitung dazu bei, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, da die Datenverarbeitung ohne aufwendige Cloud-Rechenzentren erfolgt.
Der Sustainable AI Radar von WiseWay ist ein praktisches Werkzeug, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre KI-Initiativen nachhaltig zu gestalten und ethische Aspekte systematisch zu berücksichtigen.

Auf der Website Sustainable AI Radar: Nachhaltige KI-Anwendungen umsetzen | Nachhaltige Innovation mit Verantwortung finde Sie eine Schritt-für-Schritt Anleitung zur Nutzung des Radars.
Fazit: Lokale KI ist keine Nische – sondern eine strategische Entscheidung
Unternehmen, die ihre Datenhoheit wahren, handeln nicht nur verantwortungsbewusst, sondern sichern sich einen Vorsprung im Wettbewerb. Wer lokale KI-Modelle nutzt, spart langfristig Kosten, reduziert Risiken und stärkt die Kundenbindung.
Die digitale Souveränität und der gezielte Einsatz von Local-first-KI sind für den Mittelstand nicht nur technologische Herausforderungen, sondern vor allem große Chancen, ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Durch den Einsatz datenschutzfreundlicher KI-Lösungen, eine strukturierte Vorgehensweise und die Beachtung rechtlicher sowie ethischer Rahmenbedingungen können kleine und mittlere Unternehmen ihre Prozesse effizienter gestalten.
Wir, das Mittelstand-Digital Zentrum Berlin, unterstützen Unternehmen auf diesem Weg mit praxisnahen Angeboten: Von individuellen Beratungen über Workshops und Webinare bis hin zu Pilotprojekten und Zugang zu innovativen KI-Tools bieten wir umfassende Hilfestellungen, um Digitalisierung und KI-Integration erfolgreich umzusetzen. Nutzen Sie diese Angebote, um Ihre digitale Souveränität zu stärken und mit zukunftsfähigen Technologien Ihre Unternehmensziele zu erreichen.
Quellen:
- Europe needs to decouple from Big Tech USA: Here’s 5 ways it can be achieved | TechRadar
- Percent of Corporate Data Stored in the Cloud (2024)
- Digitale Souveränität 2025
- Sustainable AI Radar: Nachhaltige KI-Anwendungen umsetzen | Nachhaltige Innovation mit Verantwortung
- Sustainable AI Radar – Tool | Nachhaltige Innovation mit Verantwortung
Text und Redaktion: Angelika Grüttner, Christel Schmuck, Alexander Krug